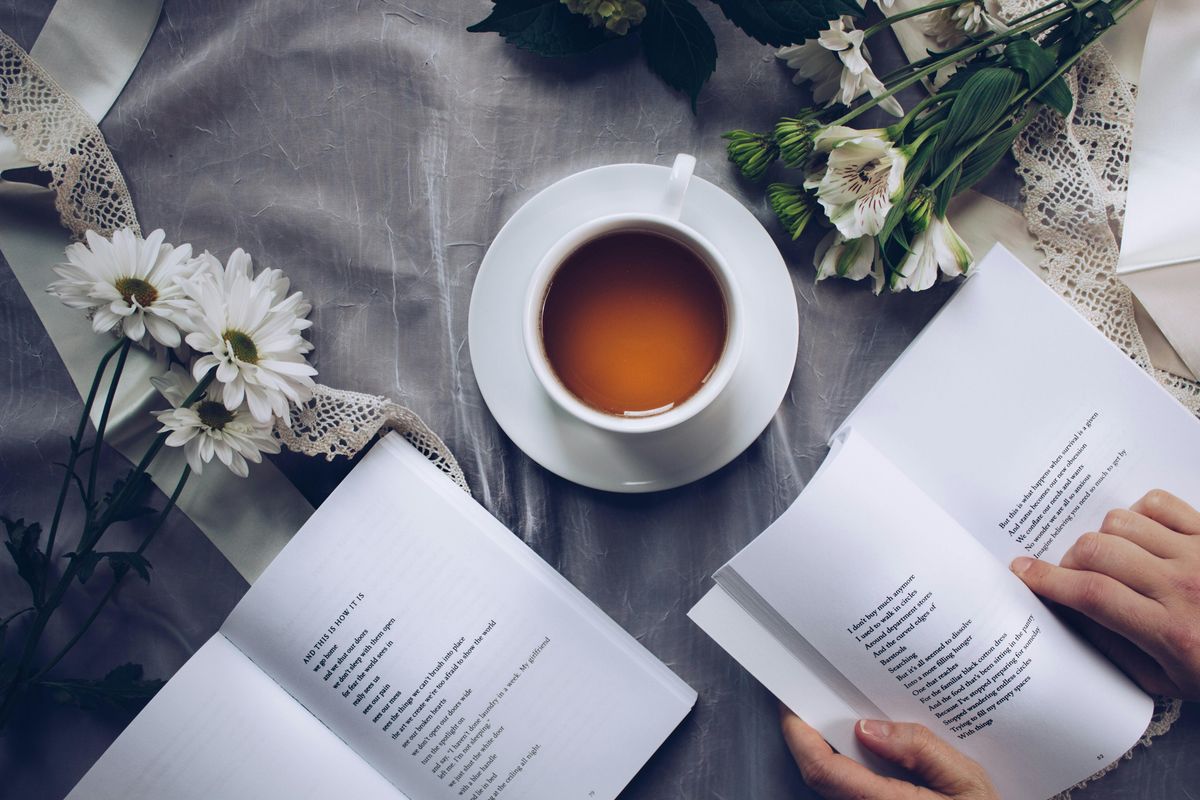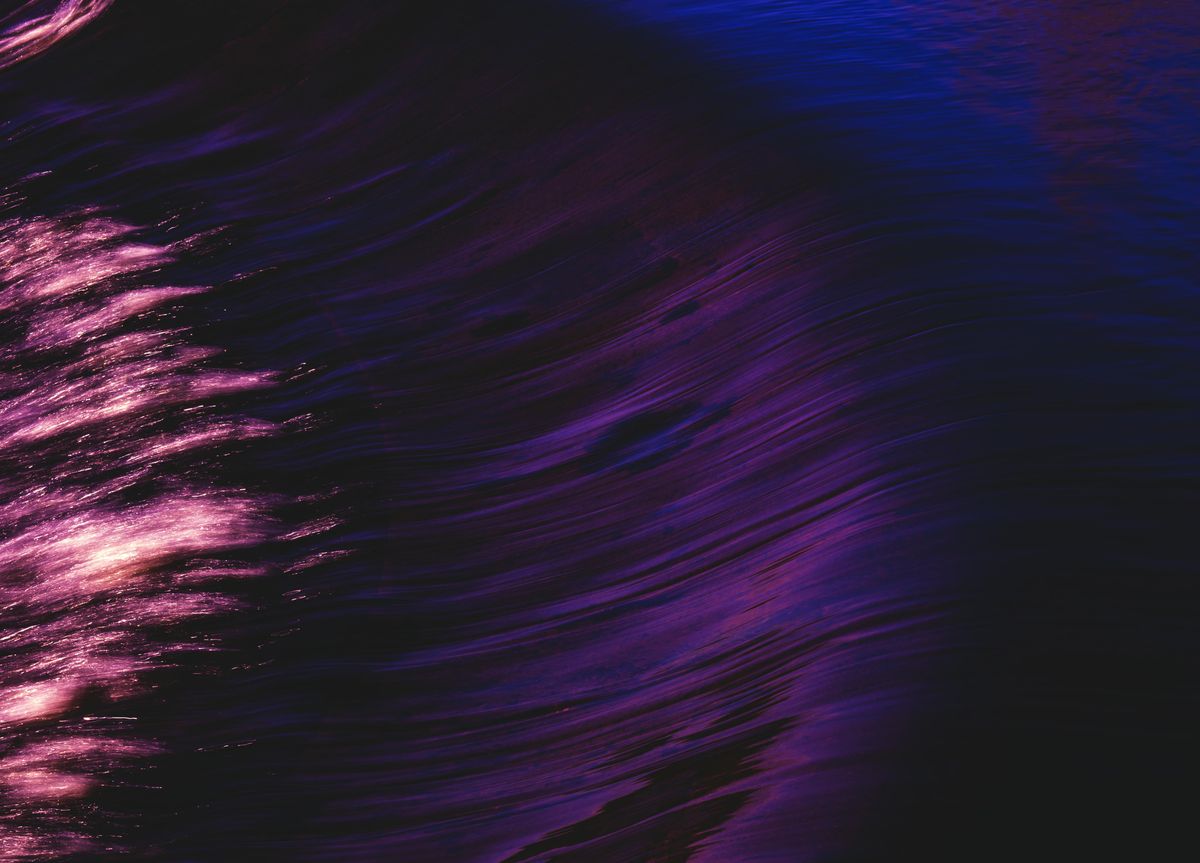| Allgemeines Begriffslexikon | |
| Alexandriner | zwölfsilbiger, bei weiblicher Endung dreizehnsilbiger Vers mit betonter 6. und 12. Silbe, benannt nach dem altfranzösischen Roman d’Alexandre (um 1180). Der deutsche Alexandriner besteht aus jambischen, meist paarweise gereimten sechsfüßigen Versen. |
| Alkäische Strophe | Nach Alkäus benannte Strophe aus zwei elfsilbigen Versen, einem neunsilbigen und einem zehnsilbigen Vers, besonders von Horaz verwendet. |
| Anapäst | Ein steigender Versfuß mit zwei Senkungen ~~_ |
| Assonanz | unvollständiger Reim, bei dem nur die Vokale übereinstimmen. Vorwiegend in der spanischen und altfranzösischen Dichtung beliebt, kommt er auch in der Deutschen Romantik vor. |
| Ballade | Erzählendes Gedicht, meist düster gestimmt, sprunghaft, oft in Dialogform. Die Blütezeit der deutschen Volksballade liegt etwa zwischen 1250 und 1450 mit Stoffen aus Epik, Geschichte und Erzählgut. Später werden andere Themen mit einbezogen, so gehören auch die Schauerballaden, der Bänkelgesang und das Zeitungslied zum Sujet. |
| Daktylus | Ein fallender Versfuß mit zwei Senkungen _~~ |
| Distichon | Strophe aus zwei verschiedenen Versen; meist Zeilenpaar aus Hexameter und Pentameter |
| Enjambement. | Übergreifen eines Satzes über das Versende hinaus. |
| Hexameter | Epischer Vers aus sechs Versfüßen, zumeist Daktylen, wobei der letzte Versfuß um eine Silbe gekürzt ist. |
| Idyll | Kleines episches oder dialogisches Gedicht, welches inhaltlich die ländliche Einfachheit, einen idealen unschuldsvollen Zustand lobpreist. Unter Theokrit wurde das Idyll zur eigenen Literaturgattung. |
| Jambus | Ein steigender Versfuß mit einer Senkung ~ _ |
| Knittelverse | Paarweise reimende, vierhebige deutsche Verse. Beim freien Knittelvers sind die Senkungen unregelmäßig gefüllt, beim strengen sind sie einsilbig. |
| Lehrgedicht | Poesie, die auf angenehme und unterhaltende Weise belehren will und dabei an keine bestimmte poetische Form gebunden ist. In der griechischen und römischen Antike wurden bestimmte Wissensbereiche in poetischer Form vorgetragen (so z.B. De rerum natura von Lukrez, Georgica von Virgil und die Ars poetica von Horaz). Die Lehrdichtung des Mittelalters ist reich an praktischen und moralischen Hinweisen. |
| Metrik | Verslehre und Verskunst |
| Minnesang | Die Liedstrophe des Minnesangs ist dreigeteilt; zwei gleich gebauten Stollen steht ein dritter abweichender Teil, der Abgesang, gegenüber. Der Reim ist kunstvoll und streng. |
| Nibelungenvers | vier paarweise reimende Langzeilen |
| Pentameter | antiker daktylischer Vers mit verkürztem drittem und letztem Versfuß, der ursprünglich zu fünf Versfüßen gezählt wurde. In der deutschen Dichtung weist der Pentameter jedoch sechs Hebungen auf und wird zusammen mit Hexametern und Distichen verwendet. |
| Reim | Gleichklang zweier oder mehrerer Silben; sprachliches Kunstmittel, daß in der Dichtung bei den meisten Völkern auftritt. |
| Rhythmus | Gliederung des Sprachablaufs im geregelten harmonischen Wechsel von langen und kurzen, betonten und unbetonten Silben durch Pausen und Sprachmelodie. |
| Saturnier | Altrömisches Versmaß, bei dem Zahl und Anordnung beträchtlich schwanken. Beste Beispiele sind die Übersetzung der Odyssee von Livius und der Punische Krieg von Naevius. |
| Sonett | Ursprünglich „Klanggedicht“, in Italien entstanden mit 14 Zeilen in zwei Teilen, von denen der erste aus zwei Strophen von je vier Versen, der zweite aus zwei Strophen von je drei Versen besteht. |
| Stabreim | Alliteration: der Stabreim ist die älteste Form der Bindung deutscher Verse (Hildebrandslied), die im 9. Jh., später auch aus der englischen und nordischen Dichtung verschwindet. Er entsteht durch Gleichheit der Anfangskonsonanten. |
| Stanze | aus Italien stammende Strophenform aus 8 Versen mit durchgehend weiblichen Endreimen. Schema ab, ab, ab, cc. Seit der Renaissance wird die Stanze besonders in epischer Dichtung verwendet. Eine Stanze mit dem Schema ab,ab,ab,ab wird Siziliane genannt. Lord Byron und Edmund Spenser verwendeten die Reimstellung ab, ab, bc, bc mit einem neunten auf c reimenden Sechsheber. |
| Strophe | mehrere Verse bilden eine größere rhythmische Einheit, die ein- oder mehrmals wiederholt wird, um ein Gedicht zu formen. Die Anfänge der Strophenbildung in Europa gehen auf Archilochos zurück, der sich auf zweizeilige (Distichen) oder dreizeilige Strophen beschränkte. Bei Alkaios und Sappho bestanden die Strophen meist aus drei oder vier Versen. In der Chorlyrik des 5. Jahrhunderts, besonders bei Pindar und im Drama oft aus zehn bis zwanzig Versen. |
| Takt | regelmäßiger Wechsel von Betonung und Nichtbetonung |
| Terzine | Strophe aus drei elfsilbigen Versen |
| Trochäus | Ein fallender Versfuß mit einer Senkung _ ~ |
| Vers | Gedichtzeile |